
Düzen Tekkal ist Autorin, Journalistin, Filmemacherin und Menschenrechtsaktivistin. Sie ist Jesidin, Kurdin und Deutsche. Sie hat vielfältige Preise und Ehrungen erhalten, u. a. das Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland am Bande. (Foto: © BASTIAN THIERY)
elevatr: Frau Tekkal, mit welcher Ihrer vielen Rollen identifizieren Sie sich am meisten?
Düzen Tekkal: Ich bin immer das, was am dringendsten benötigt wird. Gerade die Menschenrechtsverteidigerin, die sich für die Einhaltung der Menschenrechte als Basis der Freiheitsverteidigung einsetzt. In Zeiten von Spaltungsdynamiken, einer tiefen Verunsicherung von liberalen, individualisierten Gesellschaften und dem Entzug von Freiheit und Demokratie, die von vielen Akteuren bedroht wird, erachte ich es als meine Verantwortung, hier anzusetzen. Alle weiteren meiner Rollen basieren auf diesem roten Faden der Freiheit und Unabhängigkeit.
Wie sind Sie der Mensch geworden, der Sie heute sind?
Jeder Mensch ist das Ergebnis seiner Kämpfe, wir alle sind geprägt von unserer Sozialisation. Ich gehöre einer mehrfach marginalisierten Gruppe an. Auf der einen Seite war ich ziemlich deutsch, aber meine sichtbare Migrationsgeschichte hat gezeigt, dass ich Mehrfach-Identitäten habe. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich beide Seiten überzeugen muss. Ich gehörte nie einer Mehrheit an, auch nicht innerhalb der Migranten-Community. So habe ich sehr früh ein Gefühl dafür entwickelt, dass meine Identität und meine Existenz keine Selbstverständlichkeit sind. Ich musste also Qualitäten entwickeln, um gesehen, wahrgenommen und akzeptiert zu werden. Ich bin heute die, die ich bin, weil ich immer viel Widerstand erfahren habe. Aber daran bin ich auch gewachsen.
Was hat sie besonders geprägt?
Ich bin in einer kurdisch-jesidischen Familie aufgewachsen, was nicht immer einfach war. Es ging um andere Werte, andere Traditionsverständnisse, mit denen ich nicht einverstanden war. Mein Kampf hat eigentlich schon in meiner Familie begonnen. Später habe ich ihn draußen fortgesetzt. Vor allem glaube ich aber, dass mir der Zugang zu Bildung die Welt geöffnet hat. Bildung war mein Tor zur Freiheit, weil ich dadurch etwas entdeckt habe, was mir Kraft und Stärke gegeben hat und mir erlaubt hat, Stereotype infrage zu stellen. So wusste ich, wo ich hinwill.
Wohin wollten Sie?
Immer weiter. Ich wusste immer, wer ich sein will, auch wenn das pathetisch klingt. Schon zu einer Zeit, als ich nicht mal wusste, wie man Journalistin schreibt, war mir klar, dass es in diese Richtung gehen muss. Das habe ich schon in mein erstes Poesiealbum geschrieben. Aber ich wusste auch, wie weit weg das ist für ein kurdisch-jesidisches Mädchen.
Was hat Sie am Journalismus fasziniert?
Mir ging es um Hörbarkeit und Sichtbarkeit. Und um Gerechtigkeit. Ich bin mit einer gewissen Politisierung aufgewachsen und hatte schon früh das Gefühl, dass mein Menschenrechtsmuskel recht ausgeprägt war.
„Bildung hat mir erlaubt, Stereotype infrage zu stellen. So wusste ich, wo ich hinwill."
Was bedeutet „wertebasiertes Deutschland“ für Sie?
Wertebasiert heißt für mich menschenrechtsfokussiert. Im Inland wie im Ausland. Ein Land mit starkem Sozialstaat, der Menschen nicht fallen lässt. Und eine Außenpolitik, die sich nicht auf miese Deals einlässt, also beispielsweise keine Handelsverträge mit Unrechtsregimen eingeht. Ganz konkret: Nach Syrien geben wir Millionen, dann sollten wir auch Bedingungen stellen, dass Frauen- und Minderheitsrechte eingehalten werden.
Dem Nachrichtenmagazin Spiegel haben Sie kurz vor der Bundestagswahl 2025 gesagt, Deutschland fühle sich kalt an. Was meinen Sie damit?
Ich fühle in Deutschland eine gewisse Härte: Sätze werden aus dem Zusammenhang gerissen. Wir, meine Schwestern und ich, mit denen ich gemeinsam unsere beiden Organisationen leite, wachen jeden Morgen mit einem Shitstorm auf, sind Rufmordkampagnen ausgesetzt. Leute zeigen mit dem Finger auf uns und werfen uns alle möglichen –ismen an den Kopf. Und niemand verteidigt uns. Daran sollten wir uns nicht gewöhnen.
Wir leben in einer Zeit, in der wir für die Liebe und Solidarität zueinander angegriffen werden. Von irgendwelchen Internetterroristen, und von der Bewegung, die daraus entstanden ist. Diese Zerstörungswut muss aufhören. Dieser Hass, die Angst, die Wut, das bereitet mir Sorgen. Dieser Psychokrieg der Digitalisierung kreiert gemeinsam mit den Algorithmusdynamiken der sozialen Medien Rabbit Holes für Jugendliche, die ich für hochgefährlich halte. Auch deshalb bin ich für ein Handyverbot an Schulen und für eine strengere Regulierung von zum Beispiel TikTok.
Was bedeutet es Ihnen, ein Vorbild zu sein?
Vorbild zu sein, heißt nicht, perfekt zu sein. Mit diesem Vorurteil breche ich sofort. Ein Vorbild ist sich selbst treu. Darunter verstehe ich auch, etwas zu riskieren, ohne zu wissen, wie es ausgeht; für etwas einzustehen, was wichtiger ist als die Angst davor, dass es nicht klappt. Wenn mich das zum Vorbild macht bei dem einen oder anderen jungen Menschen, dann bin ich dankbar. Ich möchte ein Vorbild sein, das zäh und widerstandsfähig ist, um seine Ziele zu erreichen. Ich musste mir alles selber hart erarbeiten.
„Vorbild zu sein, heißt nicht, perfekt zu sein. Mit diesem Vorurteil breche ich sofort."
Wer sind Ihre Vorbilder?
Ich denke an meine Mutter, an meine Oma, meine Tanten. Ich denke an historische Figuren aus der Vergangenheit, an Hannah Arendt zum Beispiel (eine deutsch-US-amerikanische Philosophin und Publizistin, Anm.d.Red.). Ich habe ein ganzes Ahnenzentrum, an das ich dabei denke. Ich stelle mir immer wieder die Frage, wie andere Menschen in schwierigen Situationen gehandelt hätten. Ich habe Respekt vor jeder Frau, die das Wagnis durchlebt, in der Öffentlichkeit zu stehen. Das ist immer noch eine große Herausforderung in Zeiten von Frauenfeindlichkeit.
Woher nehmen Sie die Kraft, immer wieder Mut und Haltung zu zeigen?
Ich werde oft wach mit dem Gefühl: So nicht! Wir können das so nicht hinnehmen. Ich hasse diesen Satz: „Da können wir nichts machen.“ Das ist für mich ein Nicht-Satz. Wir können viel mehr erreichen, als uns oft bewusst ist. Freiheit beginnt im Kopf, wenn man sich von der Angst vor Reaktionen anderer Menschen befreit. Manchmal sind das auch die kleinen Verletzungen und Spitzen, die mich triggern und die ich dann in Kraft und Motivation umwandle. Für mich ist leise sein keine Option.
Für was lohnt es sich zu kämpfen?
Für Grundlegendes, also für Freiheitsrechte, für Werte. Wenn wir morgens aufstehen, müssen wir uns die Frage stellen: Wofür will ich meine Kraft heute einsetzen? Wenn wir uns dann nur mit unseren Kritikern beschäftigen, zieht das wahnsinnig viel Energie, denn das, was sie wollen, ist ja, dass wir ablassen von unserer wichtigen Arbeit. Den Gefallen dürfen wir ihnen nicht tun. Andere ziehen sich zurück, ich gehe in den Widerstand. Ich musste lernen, mir auch mal einen Rückzugsraum zu suchen, um mich zu entgiften. Denn natürlich ist auch meine Kraft begrenzt.
Wie entgiften Sie?
In mir selbst. Es ist wichtig, diese vielen Giftpfeile vorher abzufangen. Wenn man sie reinlässt, dann vergiften sie dich. Im Bestfall bedeutet das, dafür zu sorgen, dass sie abperlen, wie bei Teflon. Wenn sie einen aber mal treffen, was das Menschlichste der Welt ist, dann hilft es mir, darüber zu reden. Angriffe können ja auch beschämen, und zwar dann, wenn wir sie tabuisieren und verheimlichen. Ich rede dann mit Freunden, wenn ein Thema besonders relevant ist, auch in der Öffentlichkeit, wenn ich das Gefühl habe, dass das einen Mehrwert hat.
Wer kämpft, verliert häufig auch irgendetwas. Was war das bei Ihnen?
Ich hätte in meinem Leben nichts anders gemacht, selbst das, was ich vermeintlich falsch gemacht habe. Ich vermisse nichts. Ich habe mich für diesen radikalen Weg entschieden, weil ich das so wollte. Und ich habe auch nicht das Gefühl, auf etwas verzichtet zu haben. Manchmal, wenn es richtig heiß wird, frage ich mich schon: „Warum machst du es dir so schwer?“ Hättest du es nicht einfacher haben können? Aber ich komme immer wieder auf dieselbe Antwort: „Ne, wahrscheinlich nicht, denn das war es wert!“ Es war immer meine größte Angst, dass ich bereue, etwas gelassen zu haben.
„Da können wir nichts machen. Das ist für mich ein Nicht-Satz. Wir können viel mehr erreichen, als uns oft bewusst ist.“
Gab es diesen Moment?
Ich bin seit 2014 immer wieder im Irak und in Syrien. Einmal hatte ich die Möglichkeit, mit IS‑Kämpfern in den Gefängnissen zu sprechen, darunter auch deutsche Konvertiten. Damals habe ich mich dagegen entschieden, weil ich emotional in keinem guten Zustand war. Wenige Tage zuvor hatte ich Kindersoldaten interviewt, die nach fünf Jahren Gefangenschaft befreit wurden, da bleibt was hängen. Wir sind ja keine Roboter. Ich bin im Nachhinein sehr stolz auf meine Entscheidung. Ich misse natürlich aber auch die möglichen Erkenntnisse aus solchen Gesprächen.
Welche Rolle kann die Hotelbranche bei den Themen Politik, Religion und Haltung einnehmen?
Ich liebe diese Branche, viele meiner Verwandten sind in der Hotellerie tätig, ich bin sozusagen damit aufgewachsen. Die Branche ist für mich geprägt von Disziplin, Menschlichkeit, einem Miteinander, Herzlichkeit, harter Arbeit – und sie ist sinnstiftend. In Hotels kommen Menschen aus aller Welt zusammen. Sie sind Durchgangsstationen. Hotels sollten Orte für Weltbürger sein – und Orte, an denen sie gemacht werden. Das ist gerade in Zeiten, in denen die Zeichen der Zeit auf Abgrenzung stehen, enorm wichtig. Das fängt bei Broschüren in mehreren Sprachen an und endet bei der Auswahl am Buffet. Die Hotellerie ist ein Zimmer für alle.
Wie definieren Sie Gastfreundschaft?
Den Menschen zu sehen und so zu akzeptieren, wie er ist. Sich nicht aufzudrängen und trotzdem zu erkennen, was gebraucht wird. Herzlichkeit, Liebe, Willkommenskultur, Menschlichkeit und ein Ort, an dem man sich einfach wohlfühlt.
Können Sie einen Mutmacher für die Hotellerie ausmachen?
Die Branche kann ein Vorbild sein: In einem Hotel sollten Menschen alle gleichbehandelt werden, egal woher sie kommen, welcher Religion sie angehören oder welchen Geldbeutel sie haben. Es gibt nichts Größeres, als Menschen ein Gefühl von zu Hause zu geben in einer Zeit von Heimatlosigkeit.
Als Autorin: Welchen Buchtitel wünschen Sie sich für Deutschland in 5 Jahren?
Das Buch habe ich schon geschrieben: German Dream statt Angst.
Als Menschenrechtsaktivistin: Was braucht es, damit aus Haltung Handlung wird?
Impact, eine Wirkung. Haltung allein überzeugt niemanden. Im Gegenteil: Nicht eingelöste Versprechen – wenn ich beispielsweise an die Politik denke – erzeugen Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung und Wut. Haltungen haben den scheinbaren Vorteil, dass sie sich nie an und in der Wirklichkeit beweisen müssen. Wer handelt, geht immer ein Risiko ein. Natürlich kann man auch scheitern. Aber allein der Versuch ist schon 1000x mehr wert, als nur eine Haltung zu haben.
Als Journalistin: Funktionieren die heutigen Medien in der Gesellschaft noch so wie vor einigen Jahrzehnten?
Nein. Medienvertreter haben Glaubwürdigkeitsprobleme. Deswegen ist die Berichterstattung wichtiger denn je. Wir müssen in die Räume rein, in denen Wahrheiten, aber auch Fake News entstehen.
Als Sozialunternehmerin: Können Sie uns einen Ausblick geben, welche Projekte geplant sind?
Frauenhäuser in Syrien beispielsweise, die wir in Afghanistan und im Irak schon haben. Bildungsprojekte, zum Beispiel die bundesweiten German-Dream-Dialoge, denn Jugendliche sind das Kapital unserer Zukunft, das dürfen wir nicht nur den Extremisten überlassen.
Als Privatperson Düzen Tekkal: Was hilft Ihnen, sich in diesen herausfordernden Zeiten zu bewegen?
Mich auch über die kleinen Dinge des Lebens zu erfreuen. Und die Demut und Dankbarkeit, morgens aufzustehen, mir einen Kaffee machen zu können, meine Meinung sagen zu können, rausgehen zu können, mich frei bewegen zu können. Das klingt jetzt so profan, aber ich weiß, dass das nicht für alle eine Selbstverständlichkeit ist.
Interview FABIAN MÜLLER
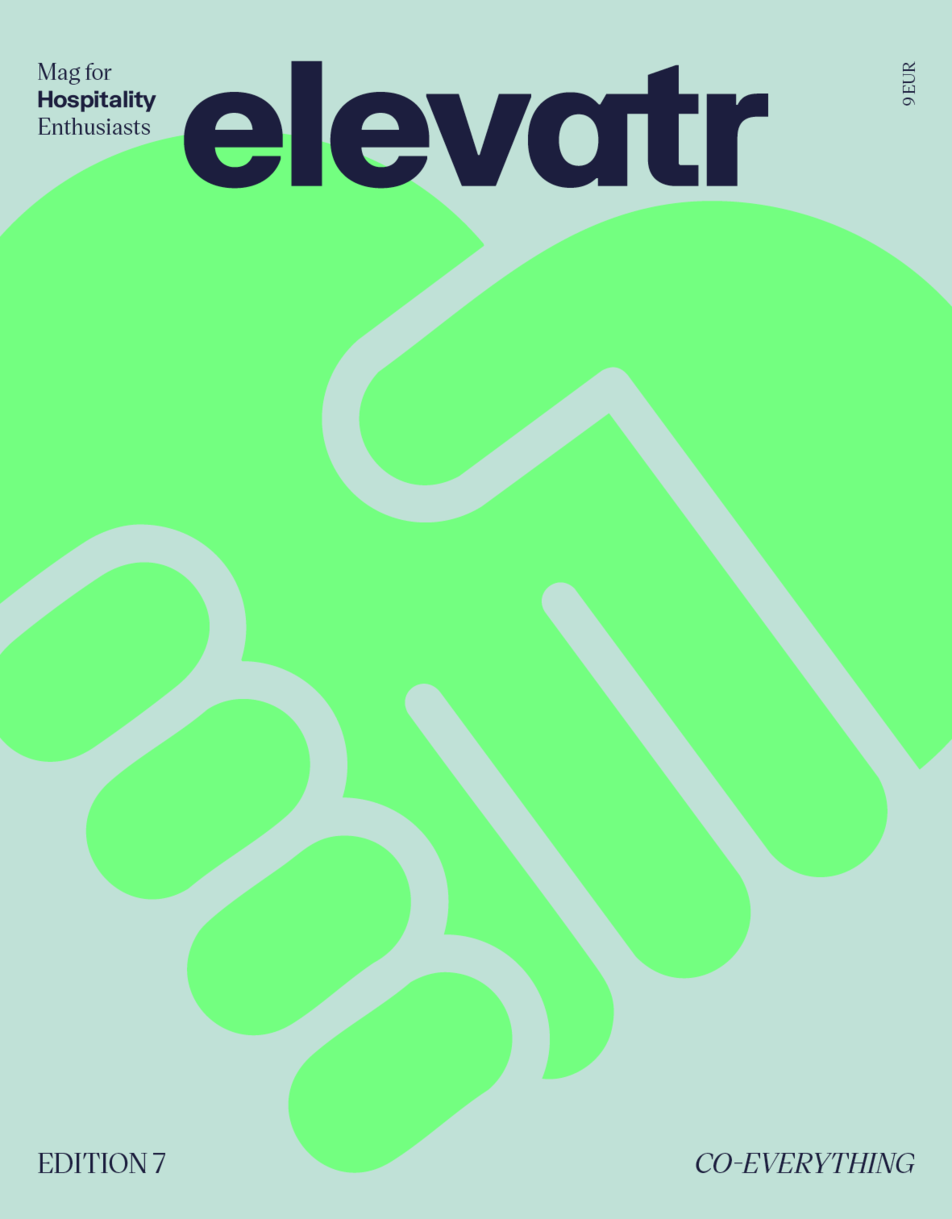
Want to read more? elevatrEdition #7 mit Schwerpunkt Co-Everything AVAILABLE NOW!